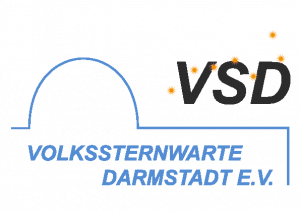Dr. Ilka Petermann – Arizona State University, Tempe/USA
Die Menschheit war und ist sich ja leider sehr selten einig. Was dem einen lieb und teuer ist dem andern ungeheuer und zwischen Podium und Scheiterhaufen hat sich der eine oder and’re auch schon mal verlaufen. Doch zumindest bei einem sind sich alle einig: die Sonne ist cool (Abb.1). Beziehungsweise faszinierend, fusionierend und fleckig, göttlich und gravitativ, windig und wichtig und – zumindest momentan in Mitteleuropa – viel zu oft hinter Wolken verdeckt.
In acht Lichtminuten Entfernung zur Erde glüht eine 1.988 x 1030 kg schwere Plasmakugel mit einer Oberflächentemperatur von 6000 Grad Celsius, die pro Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium fusioniert, was einer Leistung von knapp 4 x 1024 100-Watt Glühbirnen entspricht. Dabei verliert sie in einer Sekunde eine Million Tonnen (Wasserstoff/ Helium/ Kohlenstoff/…)-Ionen, von denen ein Teil als steter Wind die Oberfläche verlässt (und ein Bruchteil die Erde erreicht…), in manchen Fällen jedoch auch in heftigen, 40.000 km hohen Materieschleifen ausgeworfen wird. Und doch fühlen wir uns alle ungeheuer behaglich statt unbehaglich unter ihren Strahlen: der Sonne.
Seit 4.57 Milliarden Jahren hält unser Zentralgestirn Fusionsreaktionen von Wasserstoff zu Helium im Inneren aufrecht, was die nach innen gerichteten Gravitationskräfte durch den entstehenden Strahlungsdruck ausgleicht und die Sonne stabilisiert. Im Kernbereich ist gut die Hälfte der Gesamtmasse der Sonne vereinigt, und das bei einem Radius, der nur etwa ein Viertel des gesamten Radius umfasst. In diesem entsprechend dichten und heißen Bereich herrschen eine Temperatur von 15.6 Millionen Kelvin und eine Dichte, die etwa dem 13-fachen von Blei entspricht. Hier wird fast die gesamte Fusionsleistung der Sonne erbracht, die angrenzenden Schalen (Strahlungs- und Konvektionszone, Photosphäre, Chromosphäre und Korona) sind zu kühl, um Kernreaktionen aufrecht zu erhalten. Da die Sonne aus einem Plasma mit hoher elektrischer Leitfähigkeit besteht, gibt es eine starke Kopplung von Materie und einem internen Magnetfeld. Durch die spezielle Rotation der Sonne können sich die Magnetfeldlinien ‚aufwickeln‘, bis die (magnetische) Spannung so groß wird, dass selbst Alfred Hitchcock neidisch geworden wäre: Sie entlädt sich alle elf Jahre in einer Umpolung des Feldes (verknüpft mit der Sonnenaktivität), in manchen Fällen kann das Magnetfeld auch aus der Oberfläche ausbrechen, was dann als beeindruckende ‚Protuberanz‘ oder Bogen mit mitgerissener Materie in der Korona sichtbar wird. Das Zusammenspiel von Magnetfeld, der Plasmabewegung und den resultierenden feinen Strukturen der Oberfläche ist Gegenstand aktueller Forschung und mit Weltraumobservatorien und Teleskopen hofft man, die Eigenarten der Sonne, und damit auch anderer Sterne, immer besser zu verstehen.
Das Wissen, das wir heute von der Sonne haben, ist noch gar nicht so alt, doch der Gang der Sonne beschäftigte die Menschen seit jeher und rund um den Globus. So machten sich Kulturen in allen Ecken der Welt ihr eigenes Bild von der Sonnenscheibe und ihren Eigenarten und meistens war es eine Gottheit, die einige Stunden lang über den Himmel fuhr, ein Weilchen verschwand und – wenn sich die wärmeliebenden Menschen gut benommen hatten – auf der anderen Seite auch wieder auftauchte. Die Liste der Sonnengottheiten ist lang, aber die Tage zur Zeit kurz – daher sei der Ausflug, der weit im Osten startet, ein schneller (und wer ausgelassen wurde, fühlt sich hoffentlich nicht zu sehr auf den Lichtschlips getreten…).
Unter den ersten, die das neue Jahr begrüßen, sind die Neuseeländer, die 12 Stunden vor der Koordinierten Weltzeit (UTC) liegen. In der Mythologie der Maori und anderen Kulturen Polynesiens ist es ein Halbgott namens Māui, der für Sonne und Licht der Menschen besondere Kühnheit an den Tag legte. Eine seiner vielen Heldentaten war ein Kampf mit der Sonne, die er mit Hilfe seiner Brüder, einer List und letztendlich einer Attacke mit dem Knochen seines Ahnen dazu veranlasste, langsamer zu ziehen. So war es den Menschen möglich, ihr Tagwerk im wahrsten Sinne des Worte ‚am Tage‘ bei Sonnenschein zu verrichten, denn vor Māui’s Eingreifen, war der Tag zu kurz und die Bewohner konnten ihren Aufgaben nicht schnell genug nachkommen.
Im Land der aufgehenden Sonne, Japan, ist die wichtigste Gottheit des Shintoismus die Personifikation
von Sonne und Licht: Amaterasu. Sie (eine Seltenheit, sind die mächtigsten Götter doch meistens männlich) hatte sich nach einem Streit mit ihrem ungezogenen Bruder Susanoo in einer Höhle eingeschlossen, was Dunkelheit für die Welt bedeutete und den anderen Göttern einiges an Kreativität abverlangte, um sie wieder aus ihrem Versteck hervorzulocken. Ein Tanz der Ama no Uzume (übersetzt in etwa ‚das abschreckende Weib des Himmels‘) überzeugte die einsiedelnde Göttin letztendlich: sie verliess ihre Höhle und auf der Erde kam das Licht zurück. Die ‚Am Himmel scheinende große erlauchte Göttin‘, so eine Übersetzung für Amaterasu, gilt in Japan als Begründerin des japanischen Kaiserhauses.
Weiter westlich, in Indien, findet sich in den ältesten Schriften des Hinduismus eine Beschreibung von ‚Surya‘, der Personifizierung der Sonne, der Wärme und des Lichts. Wie auch in anderen Mythologien oft anzutreffen, lenkt Surya einen Sonnenwagen. Jener wird von sieben Pferden gezogen, die für die sieben Wochentage stehen; begleitet wird Surya auf dem Wagen von seiner zweiten Frau Chhaya, die ein Ebenbild seiner ersten Ehefrau Sanjna ist (und die seine gleißende Hitze nicht länger ertrug).
Drei Zeitzonen Richtung Westen ist dann die Heimat jenes Sonnengottes, der nicht nur am Himmel, sondern auch in fast jedem irdischen Kreuzworträtsel zu finden ist: Ra (manchmal auch Re), der altägyptische Sonnengott. Frühe Zeugnisse des Sonnenkultes sind Totentempel (~2700 v. Chr.) und Sonnenheiligtümer, seit 2620 v. Chr. wurden Pharaonen erstmals als ‚Sohn des Re‘ bezeichnet. Darstellungen zeigen Re als menschliche Gestalt mit Falkenkopf, der eine rote Sonnenscheibe trägt, die von einer Uräusschlange umwunden wird. Da Re als ‚Tagesgott‘ gesehen wurde, galt die Nennung seines Namens während der Nacht als Tabu und wurde von Nachtschwärmern entsprechend umschrieben.
Im (antiken) Griechenland angelangt, war ein weiterer ‚Kraftfahrer‘ unterwegs: Helios, der Sonnengott, der den Sonnenwagen, gezogen von vier Pferden, über den Himmel lenkte. Im voran ging dabei seine Schwester Eos, die Morgenröte, gefolgt von Schwester Selene, der Mondgöttin. Helios wurde oft mit einer siebenstrahligen Strahlenkrone dargestellt – der Koloss von Rhodos, eine über 30 Meter hohe Bronzestatue, die um 292 v. Chr. erbaut wurde, gilt als Standbild des Helios. Der griechische Philosoph Xenophanes war es aber auch, der erste Überlegungen anstellte, dass die Sonne ein physikalisches Objekt sein könnte. Als einer der ersten ‚Astrophysiker‘ nannte er die Möglichkeit, dass die Sonne der feurige Dunst einer Wolke sei. Auch Anaxagoras vertrat die Ansicht, dass das Himmelsgestirn keine Gottheit, sondern ein rotglühender Stein ist, welcher größer als der Peloponnes sei.
An dieser Stelle sei auch ein 1-PS-Gefährt genannt, der ‚Sonnenwagen von Trundholm‘, benannt nach der dänischen Kommune, in der ein Bauer 1902 das Artefakt beim Pflügen zufällig entdeckte. Die Skulptur wird der Nordischen Bronzezeit (etwa 1400 v. Chr.) zugerechnet und zeigt ein Pferd, das eine einseitig mit Goldblech belegte Scheibe zieht (Abb.2). Die Auswertung von Symbolen auf der Scheibe lässt unter anderem eine kalendarische Nutzung vermuten und zeugt vom astronomischen Wissensstand der damaligen Kulturen (siehe auch die ‚Himmelsscheibe von Nebra‘, Stonehenge in England oder Newgrange in Irland).
Sollte einen die Reiselust dann nach Argentinien oder Uruguay leiten, wird man auf den Flaggen der beiden Länder eine goldene Scheibe mit menschlichem Gesicht erkennen: dargestellt ist ‚Inti‘, der Sonnengott der Inka. Als Grundlage allen Lebens wurde zu Ehren der Sonne jedes Jahr zur Wintersonnenwende der südlichen Hemisphäre am 21. Juni eine große Zeremonie abgehalten. Im Jahr 1944 wurde die Tradition wiederbelebt und zieht seitdem Touristen und Besucher der Umgebung gleichermaßen an.
Von einem besonderen Appetit des Inti ist nichts bekannt – ganz im Gegensatz zum Sonnengott der aztekischen Mythologie, Tonatiuh (Abb.3). Der ‚Er geht hin um zu leuchten und wärmen‘ (so die Übersetzung der aztekischen Sprache Nahuatl) war von seinem nächtlichen Weg durch die Unterwelt so geschwächt, dass er ein Lebenselixier brauchte: Menschenblut. Der Opferkult der Azteken erreichte um das 15. Jahrhundert seinen Höhepunkt und je nach Quellen geht man von mehreren Tausend oder einigen Zehntausend Opfern pro Jahr aus, um den Gang der Sonne zu erhalten. Ob das der Wahrheit entspricht oder aber die Azteken selbst oder die spanischen Eroberer übertrieben haben, lässt sich nicht mehr sagen – das weiss allein die Sonne, die nach wie vor unermüdlich auf- und untergeht…
Im Laufe der Zeit rückte man von der Mythologie etwas ab und ab dem 17. Jahrhundert dann der Sonne etwas mehr auf die Pelle, bzw. Photosphäre: Galileis Teleskop erlaubte es zum ersten Mal, feine Strukturen der Sonnenoberfläche zu beobachten. Galileo Galilei, Thomas Harriot, Johann Fabricius und Christoph Scheiner waren die ersten, die Sonnenflecken (Abb.4) entdeckten und zu interpretieren suchten – ein schwieriges Unterfangen, da nach der damaligen Lehrmeinung die Sonne als ‚reiner Körper‘ keinerlei Strukturen aufweisen sollte. Im 18. Jahrhundert dann vermutet Christian Horrobow, dass die nunmehr akzeptierten Flecken einer Periodizität unterliegen. 1843 publiziert Samuel Schwabe schließlich eine Abhandlung zum Zyklus der Sonnenfleckenaktivität. Und der Schweizer Astronom Rudolf Wolf ist es, der sechs Jahre später die sogenannte ‚Sonnenfleckenrelativzahl‘ einführt, die ein Maß für die Anzahl von Einzelflecken und Fleckengruppen ist. (Amateur-)Astronomen weltweit tragen seitdem ihre Beobachtungen der Sonnenflecken in dem gemeinsamen Schema zusammen, das als Maß für die Sonnenaktivität wertvolle Langzeit-Daten über unser Zentralgestirn liefert.
Eine andere Art von ‚Dunkelheit‘ fand 1802 William Wollerston: er beobachtete dunkle Linien im Sonnenspektrum, die später von Joseph von Fraunhofer systematisch untersucht wurden. Dabei stellte sich heraus, dass man Absorptionslinien von Elementen der Sonnenatmosphäre sah. Durch eine Analyse der einzelnen Wellenlängen lässt sich somit auf die Elementzusammensetzung der Sonne schließen. Wobei der französische Astronom Jules Janssen 1868 allerdings über Spektrallinien stolperte, die zu keinem der bekannten Elemente passten: das damals noch unbekannte Element Helium war entdeckt und wurde nach dem griechischen Sonnengott Helios benannt. Turbulenzen sowie Absorption und Streuung an den Molekülen der Erdatmosphäre setzen dem klaren Blick auf Details der Sonnenoberfläche diesige Grenzen, sodass für genauere Studien nur der Flug in große Höhen bleibt oder erdgebundene Teleskope mit zusätzlicher Technik ausgestattet sein müssen.
Die Weltraumstation ‚Skylab‘, von 1973-1979 in Betrieb und bis heute die erste und einzige rein amerikanische Station, bot zum ersten Mal die Möglichkeit, mit einem eigenen Teleskop längere Sonnenbeobachtungen ohne störende Atmosphäreneinflüsse durchzuführen. Während ihrer knapp 35.000 Erdumkreisungen wurden über 177.000 Sonnenaufnahmen gemacht, die wertvolle neue Informationen über die Chromosphäre und die Korona lieferten.
Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eher ein grober Richtwert denn ein Genuss-Schluss ist, gilt nicht nur für die Vorratskammer, sondern auch für die beiden Helios-Sonden (ESA und NASA): Für 18 Monate konzipiert, sammelten und sendeten sie elf bzw. sechs Jahre Daten zur Erde, dabei näherten sie sich der Sonne auf nachbarschaftliche 46.5 Millionen Kilometer (43.5 Millionen Kilometer, Helios 2). Damit die Sonden sich nicht die ‚Flügel‘ verbrannten, wurden sie nicht nur gut isoliert, sondern rotierten auch schnell um die eigene Achse. So konnte die Dauer der Sonneneinstrahlung auf einen einzelnen Abschnitt minimiert werden und die Hitze verteilte sich gleichmäßiger – an der Außenhülle wurden es immerhin 300 Grad, bei angenehmen 20 Grad im Innern. Die Daten von Helios 1 und 2 trugen unter anderem zu einem besseren Verständnis des Sonnenwindes bei, wobei die lange Einsatzdauer von großem Vorteil war, da der Sonnenzyklus zwischen einem Minimum bis zu seinem Maximum verfolgt werden konnte.
Mit ‚Ulysses‘ (1990-2009) flog dann erstmalig eine Sonde über die Sonnenpole, und das seit 1995 aktive ‚Solar and Heliospheric Observatory‘ SOHO untersucht mit zwölf verschiedenen Instrumenten so unterschiedliche Aspekte wie die Zusammensetzung des Sonnenwindes, die (UV-)Strahlungsverteilung oder das Oszillationsverhalten der Sonne (Abb.5).
Wer lieber auf dem Boden bleiben möchte, dem stehen aber auch Teleskope zur Sonnenbeobachtung zur Verfügung, die hervorragende Auflösung dank adaptiver Optik erzielen. Die Technik, die in den 1970ern im militärischen Bereich entwickelt und in den 1990ern erstmals für die beobachtende Astronomie eingesetzt wurde, kompensiert Störungen durch Atmosphärenturbulenzen etwa über Kippspiegel oder Spiegel mit verformbarer Oberfläche (Flüssigkristall-Spiegel). Das größte europäische Teleskop, GREGOR, befindet sich auf dem Berg Izana, Teneriffa, auf 2400 Meter Höhe und wird für die Untersuchung kleiner Sonnenstrukturen eingesetzt. Eine Winkelauflösung von 0.1 Arcsecond ermöglicht so die Auflösung von Strukturen mit Durchmessern um 70 km auf der Sonne! Das weltgrößte Sonnenteleskop, das McMath–Pierce Solar Telescope (Abb.6), steht auf dem Kitt Peak in der Nähe von Tucson (Arizona, USA) und damit in einer Gegend, die extra keine Sommerzeit eingeführt hat: Die Sonne scheint hier von einem dauerwolkenlosen Himmel sowieso so lang (und so heiß…), dass man auf das Stündchen Extra-Sonne gerne verzichtet hat.
Und auch für den Mittelweg gibt es eine Lösung in Form eines Ballons, der so groß ist, dass die Dresdner Frauenkirche locker darin Platz hätte: das SUNRISE-Teleskop, das an einem Helium-Höhenballon montiert ist. Vollständig aufgebläht misst der Überflieger grob 100 Meter im Durchmesser und steigt auf eine Arbeitshöhe von gut 30 km. Dort ist die Restatmosphäre so gering, das die UV-Strahlung ungefiltert auf die Messinstrumente trifft, was es erlaubt, Prozesse des Magnetfeldes und der Plasmaströmungen in der unteren Sonnenatmosphäre zu untersuchen. Nach einem mehrtägigen Einsatz kann das Teleskop zur Erde zurückkehren und so für weitere Missionen ‚recycelt‘ werden.
Wenn sich in wenigen Tagen das Jahr 2017 seinem Ende zuneigt, hat die Tageslänge im Vergleich zur Wintersonnenwende am 22.12.2017 bereits um üppige fünf Minuten zugelegt – die so gewonnenen Tageslichtminuten könnte man dann zum Beispiel für’s Nachschlagen des Stichworts ‚Sonne‘ in der Wikipedia nutzen: in knapp 240 Sprachen stehen mehr oder weniger lange Artikel zur persönlichen Erleuchtung zur Verfügung. In diesem Sinne: ein frohes und leuchtendes neues Jahr 2018!